Vermittlung
der Dialogfähigkeit mit anderen Kulturen innerhalb und außerhalb des Islam als Aspekt
der interkulturellen Korandidaktik
Dr.
phil. Milena Azize Rampoldi
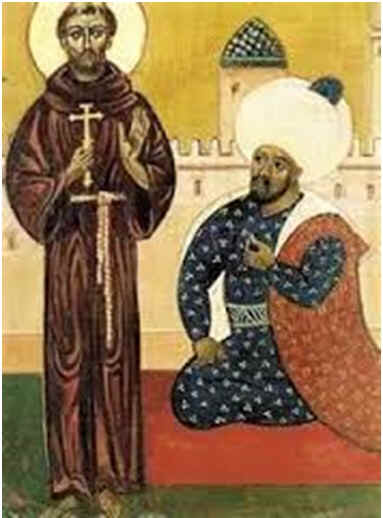
Ich
bin der Überzeugung, dass die interkulturelle Korandidaktik im deutschen Sprachraum
wesentlich auf die Dialogfähigkeit fokussieren soll, um die muslimischen Kinder und
Jugendlichen zu dialogfähigen, muslimischen Weltbürgerinnen und Weltbürgern zu
erziehen.
Meiner
Ansicht nach kann man die Dialogfähigkeit im Allgemeinen als die Fähigkeit definieren,
auf andere zuzugehen, sie als Partner wahrzunehmen, sie ernst zu nehmen, eine Beziehung zu
ihnen herzustellen, Lösungen miteinander auszuhandeln, konstruktiv Probleme anzugehen und
in der Lage zu sein, diese zu lösen.
Somit
gilt die Dialogfähigkeit vor allem im interkulturellen und interreligiösen Bereich als
grundlegend für das Zusammenleben.
Diese
Dialogfähigkeit sollte daher im Koranunterricht ab der Grundschule als vorrangiges
Lernziel gelten. Die Dialogfähigkeit mit den anderen Kulturen ist vor allem für die
muslimischen Kinder wichtig, die in einer nicht-muslimischen Umgebung aufwachsen, wie zum
Beispiel in einem westlichen Land. Es ist ausschlaggebend, dass die Kinder genug vom Islam
lernen und ausreichende Informationen über ihre Religion besitzen, um auch darüber
sprechen zu können.
Selbstverständlich
sollten dieses Sprechen und dieses Erzählen über den Islam altersgerecht und im Einklang
mit der kognitiven und emotionalen Entwicklung des einzelnen Kindes erfolgen.
Im
Alltag der Musliminnen und Muslime kommt es nämlich sehr oft vor, gefragt zu werden,
warum man etwas denkt oder aus welchem Grunde man auf eine gewisse Art und Weise handelt
und lebt. Es kann auch im schulischen Alltag vorkommen, dass die muslimischen Kinder in
einer multikulturellen Schulklasse dazu beitragen können, Inhalte vorzustellen, die den
Islam und ihre Kultur und die geografischen, historischen und sozialen Bedingungen ihrer
Herkunftsländer betreffen.
In
diesem Zusammenhang muss sich vor allem das Gastland darauf einstellen, die Anwesenheit
der muslimischen Kinder als Bereicherung und nicht als Hemmschuh anzusehen. Um dies zu
erreichen, kann man gleichzeitig auch viel tun, um tief verankerte Vorurteile gegenüber
dem Islam zu überbrücken.
Für
die muslimischen Kinder ist die Erziehung zum Dialog andererseits auch für sich selbst
wichtig, da der Dialog im positiven Sinne dazu beiträgt, Belastungen und frustrierende
Erfahrungen im Kontakt mit ihren andersgläubigen Kameraden zu verhindern. Abdoldjavad
Falaturi spricht in Guide to the Presentation of
Islam in School Textbooks, S. 184, in diesem Zusammenhang von einem unbelasteten
Dialog als Garant des gerade heutige so notwendigen Weltfriedens:
„Dialog
aus Neugier, Dialog aus Noch-mehr-wissen-Wollen kann nur bei unbelasteten Beziehungen
stattfinden; ein fruchtbarer verheißungsvoller, zukunftsweisender Dialog; ein Garant, ein
idealer Garant für den Weltfrieden“.
Was
aber auch für ein Kind als bedeutend erscheint, ist die Beständigkeit der eigenen Kultur
und Umgebung. Dass die muslimischen Kinder aus Ländern stammen, in denen es Kultur und
Traditionen gibt, die erzieherisch auf die Menschen wirken, dessen müssen sich die Kinder
als erste bewusst sein, vor allem, weil sie sich als Migrantenkinder räumlich neu
orientieren und auf zahlreiche Hindernisse stoßen, die sie nur überbrücken können,
wenn sie eine starke Identität und viel Selbstbewusstsein besitzen.
Und
während sie dieses Bewusstsein für die eigene länderspezifische muslimische Kultur
aufbauen, sehen sie auch die Unterschiede zu den anderen muslimischen Ländern, aus denen
ihre Mitschüler und Mitschülerinnen im Koranunterricht stammen. Das ist ein sehr guter
Ansatz, um an den Unterschieden schon innerhalb des Islam zu arbeiten, bevor man auf die
Kultur des Gastlandes und der anderen nicht-muslimischen Länder der Welt sieht.
Dieser
Dialog ist unentbehrlich, damit sich keine Parallelgesellschaften im Gastland bilden, die
neben der sogenannten deutschen Leitkultur entstehen und mit dieser nicht mehr
kommunizieren wollen. Anstatt dessen kann durch Dialog eine gemeinsame Anerkennung
allgemeiner menschlicher Werte entstehen, die eine wahre, multikulturelle Gesellschaft am
Leben erhält, weil jeder Mensch darin in seiner Würde anerkannt und wahrgenommen wird.
In
einem darauffolgenden Schritt kommt das Bewusstsein des Gastlandes, dass es sich bei den
muslimischen Kindern nicht um kulturlose Menschen handelt, die vom Westen erst zivilisiert
werden müssen, sondern um Kinder, die ihre eigene Kultur mitnehmen und sich mit ihr auch
außerhalb ihres Herkunftslandes auseinandersetzen, wenn auch in einem oft komplexen
Prozess der räumlichen Neuorientierung im Westen.
Dialog
kann erst entstehen und fruchtbar sein, wenn die DialogpartnerInnen sich auch des Wertes
der eigenen Kultur und Religion bewusst sind. Mit einem Anderen über die eigene Religion
zu sprechen, bedeutet dialogfähig zu sein, ohne unbegründete Angst davor haben zu
müssen, die eigene religiöse Welt aufzugeben.
Auf
beiden Seiten gibt es noch große Hürden, die es zu überwinden gilt, um den wahren
Dialog zu fördern. Vor allem soll auf beiden Seiten die Vorstellung überwunden werden,
Dialog mit Missionierung gleichzusetzen. Die Koranschule ist jedoch alleine nicht dazu
fähig, eine solch große Arbeit zu bewältigen, die beim Koranlehrer/der Koranlehrerin
selbst anfangen sollte. Meiner Meinung nach gilt es als wesentlich, dass die Lehrpersonen
den Weg zum Dialog selbst beschreiten, bevor sie ihn ihren Schülern und Schülerinnen
aufzeigen.
Wenn
die muslimische Familie und Gemeinde diese Erziehung zum interreligiösen Dialog und zur
interreligiösen, sachlich und historisch fundierten Bildung nicht unterstützen, sind
aber die hier dargelegten Bemühungen von Anfang an zum Scheitern verurteilt.
@ Ekrem Yolcu

|







